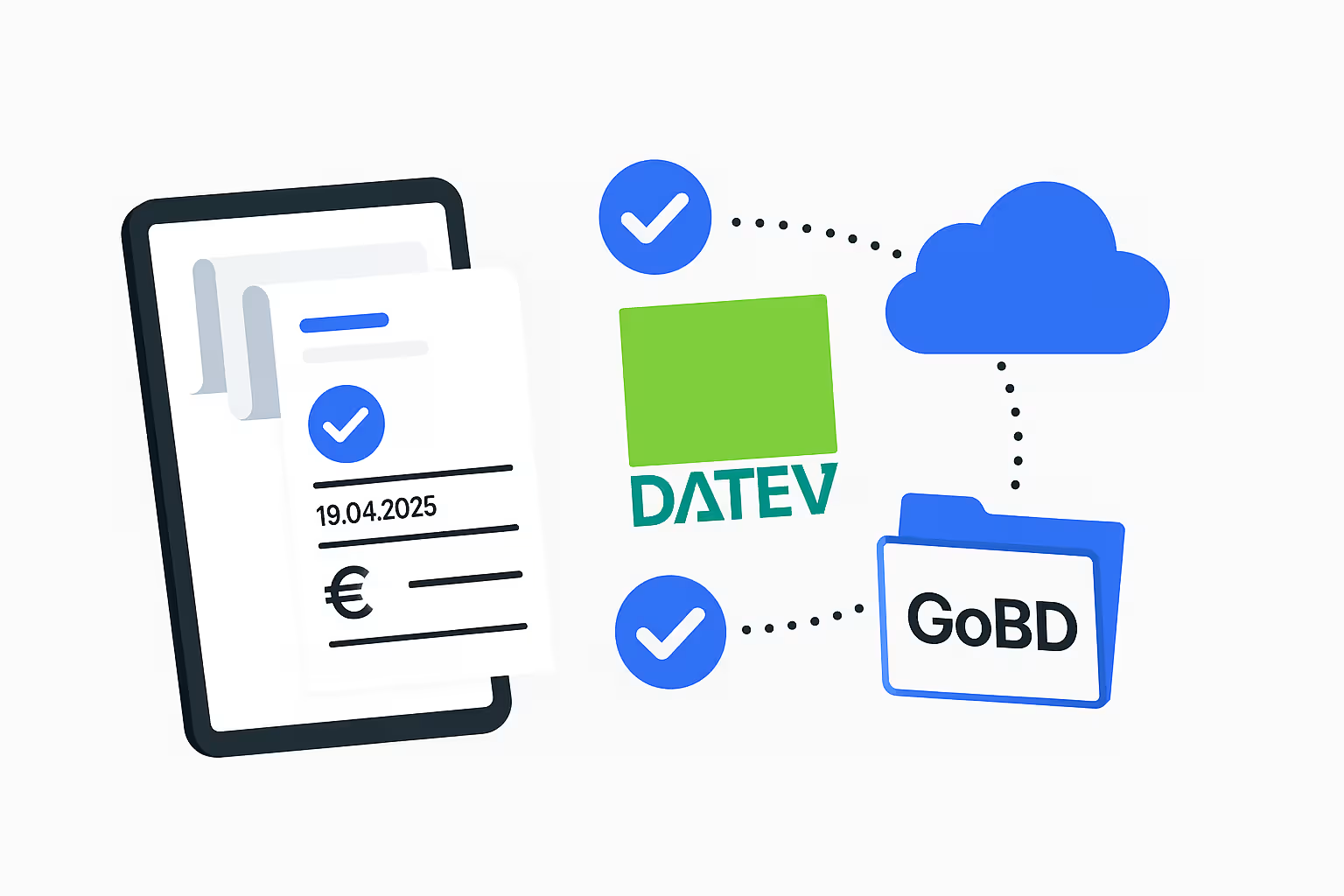Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (kurz EÜR) handelt es sich um eine einfache und gängige Methode, den Gewinn eines Unternehmens zu ermitteln. Diese Form der Gewinnermittlung ist vor allem für kleinere Betriebe ohne Bilanzierungspflicht interessant – auch oder gerade im Handwerk. Doch was gilt es dabei zu beachten?
In diesem Beitrag erfährst Du Schritt für Schritt, wie die EÜR aufgebaut ist, welche Einnahmen und Ausgaben Du dabei berücksichtigen musst und wie Du typische Fehler vermeiden kannst. Zusätzlich erfährst Du, welche Rolle eine Software wie ToolTime übernehmen kann, wenn es darum geht, die EÜR ganz einfach digital zu erstellen.
Was ist die Einnahmen-Überschuss-Rechnung?
Eines haben alle Unternehmen in Deutschland gemeinsam: Das Finanzamt möchte wissen, wie viel Gewinn oder Verlust das jeweilige Unternehmen erwirtschaftet hat. Um diese Werte zu ermitteln, gibt es mehrere Wege. Berechtigte Unternehmen oder Selbstständige können auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung zurückgreifen. Der Sinn hinter dieser Methode ist, dass die Gewinnermittlung vereinfacht werden soll. Und diese Variante ist tatsächlich deutlich einfacher als die klassische doppelte Buchführung. Im Einkommensteuergesetz ist die EÜR nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz als „Überschuss der Betriebseinnahmen über die -ausgaben" geregelt.
Im Wesentlichen werden bei der EÜR also die Einnahmen und die Ausgaben aufgelistet und gegenübergestellt. Wenn Einnahmen auf das Konto kommen, werden sie erfasst und wenn Ausgaben vom Konto weggehen, werden sie ebenfalls erfasst.
Am Ende ergibt sich folgende Rechnung: Betriebliche Einnahmen – betriebliche Ausgaben = Gewinn/Verlust.
Wer darf die EÜR nutzen?
Grundsätzlich heißt es: Wenn Unternehmen nicht zur Bilanzierung verpflichtet sind, sprich, wenn sie zu keiner doppelten Buchführung verpflichtet sind, dürfen sie eine EÜR erstellen. Doch welche Unternehmen betrifft das?
- Gewerbetreibende (Einzelunternehmen oder GbR)
- Freiberufler
- Kleinunternehmen mit maximal 22.000 Euro Umsatz pro Jahr
- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Zusätzlich gelten gewisse Umsatzgrenzen, um die Einnahmen-Überschuss-Rechnung anwenden zu können. Gewerbetreibende (Einzelunternehmen oder GbR) dürfen im Jahr höchstens 600.000 Euro Umsatz und 60.000 Euro Gewinn erwirtschaften. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe haben ebenfalls eine jährliche Höchstgrenze von 60.000 Euro Gewinn.
Es wird damit schon hier deutlich: Diese Anforderungen erfüllen auch viele kleinere oder neu gegründete Handwerksbetriebe. Bis zu einer gewissen Höhe an Umsatz oder Gewinn können diese Unternehmen noch von der einfacheren EÜR profitieren.
So funktioniert die Einnahmen-Überschuss-Rechnung im Handwerk
Die EÜR ist jährlich bis zum 31. Juli des Folgejahres einzureichen. Seit 2017 musst Du sie elektronisch über ELSTER an das Finanzamt übermitteln – mit dem offiziellen Formular „Anlage EÜR“. Das Formular enthält unter anderem die Angaben zu den Betriebseinnahmen, die Betriebsausgaben nach Kategorien, die Ermittlung des Gewinns, die Abschreibungen und Rücklagen sowie Investitionsabzugsbeträge.
Welche Angaben gehören in die EÜR?
Auch bei der Auswahl der nötigen Angaben sollten wir noch kurz näher ins Detail gehen. Immerhin gibt es auch dort ein paar wichtige Unterscheidungen. Zunächst müssen die Einnahmen und Ausgaben nach Steuersätzen und steuerfreien Umsätzen getrennt und erfasst werden. Abnutzbare Anlagegüter wie Computer oder Maschinen können zudem abgeschrieben werden – dazu etwas später mehr. In der dazugehörenden Abschreibungsübersicht werden die wesentlichen Daten rund um Anschaffungsdatum, Kaufpreis und Abschreibungsdauer erfasst.
Übliche Einnahmen eines Handwerksbetriebs
- Erlöse durch Handwerksleistungen
- Materialverkäufe
- Erlöse durch Serviceeinsätze
- Skonti, Boni oder Zinsen (sofern betrieblich eingenommen)
Übliche Ausgaben eines Handwerksbetriebs
- Materialkosten
- Anschaffung von Werkzeugen
- Kfz-Kosten
- Büromaterial
- Telefongebühren
- Versicherungen
- Miete
- Strom
- Wasser
- Fortbildungskosten
Was Du beim Thema Abschreibungen beachten musst
Du kannst nicht alle Ausgaben sofort in voller Höhe in der EÜR absetzen. Das gilt vor allem für größere Anschaffungen, die Du über mehrere Jahre hinweg im Betrieb nutzt. Dazu zählen etwa Maschinen, Fahrzeuge oder Computer. Derartige Investitionen werden in der Steuererklärung nicht auf einmal, sondern schrittweise über mehrere Jahre verteilt berücksichtigt.
Das Ganze nennt sich „Abschreibung“ oder offiziell: Absetzung für Abnutzung (AfA). Dahinter steckt die Idee, dass Du von größeren Investitionen auch über längere Zeit profitierst – und genau das soll sich in Deiner Gewinnermittlung widerspiegeln.
Wie lange ein Gegenstand abgeschrieben werden muss, hängt von seiner voraussichtlichen Nutzungsdauer ab. Richtwerte dazu findest Du in den sogenannten AfA-Tabellen der Finanzverwaltung.
Beispiel:
Du kaufst Dir einen Werkstattwagen für 6.000 Euro netto. Die übliche Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle beträgt 6 Jahre. → Du darfst jedes Jahr 1.000 Euro als Ausgabe in Deiner EÜR absetzen.
So hilft Dir ToolTime bei der EÜR
Wenn Du ToolTime nutzt, kannst Du alle Zahlungseingänge sowie Ausgaben direkt erfassen und damit den Überblick über wichtige Daten für Deine EÜR behalten. Noch besser ist es, wenn Du ToolTime gemeinsam mit Lexware nutzt. Über die Lexware Office Schnittstelle werden in ToolTime erstellte Rechnungen automatisch in Deinen Lexware-Account übertragen – und das in Echtzeit. Das sorgt für ein nahtloses Zusammenspiel von Rechnungs- und Zahlungsmanagement und erleichtert Dir so die spätere Gewinnermittlung enorm.
Fazit
Die EÜR ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode zur Gewinnermittlung, besonders für kleinere Handwerksbetriebe. Mit etwas Grundwissen und einer guten Struktur lassen sich Einnahmen, Ausgaben und Abschreibungen sicher und nachvollziehbar dokumentieren. Digitale Tools wie ToolTime unterstützen Dich dabei, alle relevanten Geschäftsvorgänge sauber zu erfassen und Dir damit mehr Zeit fürs Handwerk zu verschaffen.